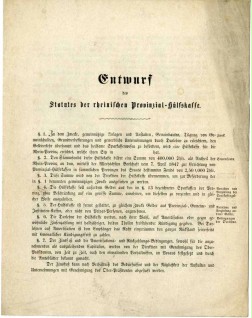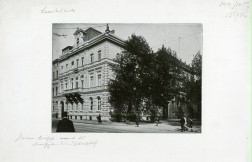|
Von Beginn an war der Einfluss der rheinischen Provinzialverwaltung dominierend, da drei der vier Direktorenposten von den Provinzialständen besetzt wurden. Die Rolle des preußischen Staates beschränkte sich auf die Kontrolle durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz und die Oberaufsicht des preußischen Innenministers. Zweck des neugründeten Instituts war gemäß ihres Statuts, "gemeinnützige Anlangen und Anstalten, Gemeindebauten, Tilgung von Gemeinschulden, Grundverbesserungen und gewerbliche Unternehmungen durch Darlehne (!) zu erleichtern"[2]. Institut und Ausrichtung waren jedoch keine rheinische Erfindung. Als Vorläufer der rheinischen Provinzial-Hülfskasse ist die "Hülfskasse für die Provinz Westfalen" anzusehen, die am 5. Januar 1832 auf Initiative des damaligen Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Ludwig von Vincke, ihren Betrieb aufnahm.
Die Bank gewährte in den ersten Jahren dementsprechend vor allem Kommunen, Einrichtungen und Verbänden langfristige Kredite, wohingegen Privatpersonen nur einen sehr überschaubaren Geschäftsanteil ausmachten. Unter anderem erhielt die Provinzial-Blinden-Anstalt in Düren ein langfristiges Darlehen. Darüber hinaus wurden der Straßen- und Wegebau sowie Maßnahmen gefördert, die dem Landesausbau (Meliorationen) dienten[3]. Dahingegen war der Hilfskasse per Statut untersagt, Einlagen von Privatpersonen anzunehmen. Die Geschäftspolitik blieb aber nicht ohne Widerspruch. So kritisierte bereits 1860 der Velberter Bürgermeister Sternberg die Verteilung der Geldmittel[4]. Als "Grundausstattung" stellte der preußische Staaat ein Stammkapitel von 400.000 Taler zur Verfügung. Zwar war die Provinzialhülfskasse als gemeinnütziges Institut gegründet worden, deren vorrangiger Zweck nicht die Gewinnmaximierung sein sollte. Dennoch erwirtschaftete sie Überschüsse. Die Zinsgewinne des Instituts wurden zunächst geviertelt. Die Hälfte der Zinsgewinne war als Prämie für Sparkassenkunden vorgesehen. Ein Viertel wurde zur Erhöhung des Stammkapitals verwendet. Über ein weiteres Viertel – den "Ständefonds" – konnte der Landtag der Rheinprovinz frei verfügen. Nach einer Umverteilung im Jahr 1872 wurde der Anteil des Fonds auf 75 Prozent erhöht. Für die Provinzialstände bedeuteten die jährlichen Gelder eine wichtige Einnahmequelle, die sie unter anderem zugunsten der Provinzial-Museen in Trier und Bonn oder zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen einsetzen. Über Einnahmen und die Verwendung der Mittel hatte das Institut jährlich dem Provinzialausschuss der Rheinprovinz Bericht zu erstatten. Ab den 1860er Jahren wuchsen Tendenzen in Preußen, die Verwaltung stärker zu dezentralisieren und den Provinzen mehr Selbstverwaltungsrechte zu gewähren. Diese brachten für die Rheinprovinz weitreichende Konsequenzen mit sich, die sich auch auf die Rheinische Provinizial-Hülfskasse auswirkten. Mit den sog. "Dotationsgesetzen", die den preußischen Provinzen einen höheren Grad an Selbstverwaltung ermöglichten, ging zunächst die Leitung und 1875 auch das Eigentum an der Provinzial-Hülfskasse an den Provinzialverband über[5]. Dieser Wechsel drückte sich sichtbar dadurch aus, dass die Provinzial-Hülfskasse nur zwei Jahre später von Köln nach Düsseldorf umzog.
|