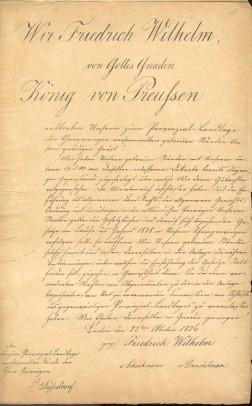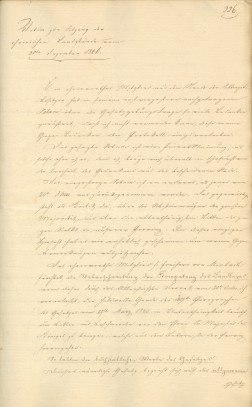|
Fußnoten [1] Dabei handelte es sich u.a. um die linksrheinischen Teile der Kurpfalz, die Gebiete einiger kleiner Herzogtümer am Rhein, die linksrheinischen Gebiete der 1803 aufgelösten Erzbistümer Köln, Mainz und Trier, das Gebiet der Reichsstadt Aachen sowie weitere Gebiete, die ab 1816 den bayerischen Rheinkreis (Rheinpfalz) und die hessische Provinz Rheinhessen bildeten. [2] Bestehend aus dem „Code civil“ bzw. „Code Napoléon“ (bürgerlich-ziviles Gesetzbuch, 1804), dem „Code de procédure civile“ (Zivilprozessbuch, 1806), dem „Code de commerce“ (Handelsgesetzbuch, 1807), dem „Code d’instruction criminelle“ (Strafprozessordnung, 1808) sowie dem „Code pénal“ (Strafgesetzbuch, 1810). Vgl. dazu u.a. Werner Schubert (Hg.), Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zivilrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Zivilprozessrecht, Köln 1977; Werner Schubert (Hg.), 200 Jahre Code civil. Die napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa, Köln 2005 (Rechtsgeschichtliche Schriften 21) und Karl D. Wolff (Hg.), Code Napoléon. Napoleons Gesetzbuch, Frankfurt am Main 2001. [3] Vgl. Sabine Graumann, 1794 bis 1815 - Aufbruch in die Moderne. Die "Franzosenzeit", in: Internetportal Rheinische Geschichte, online hier verfügbar (abgerufen am: 03.05.2019) und Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz (Hg.), 200 Jahre Code civil im Rheinland. Eine Ausstellung der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Saarbrücken und den Oberlandesgerichten Koblenz und Zweibrücken, Koblenz 2005 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 104), S. 76-79. [4] Das Heilige Römische Reich als feudaler Stände- und Lehnsverband stellte ein Konglomerat zahlreicher weltlicher und geistlicher Mittel-, Klein- und Kleinststaaten mit jeweils unterschiedlichen Gesetzgebungen und Rechtsinstitutionen dar. Auch innerhalb der Territorien gab es oftmals verschiedene Unterherrschaften mit eigener Jurisdiktion und Gerichtsorganisation. So herrschte auch in den linksrheinischen Gebieten eine unüberschaubare Rechtszersplitterung mit einem nur hinreichend funktionierenden Gerichtswesen und einem veralteten, oftmals nicht gedruckt vorliegenden Recht vor. Nach der Annexion durch die Franzosen und der Einführung der französischen Rechtsordnung galt nun erstmals für das ganze Rheinland im Wesentlichen das gleiche Recht. Vgl. Graumann, Die "Franzosenzeit“. [5] Säkularisiert meint die Verweltlichung, also die Aufhebung kirchlicher Institutionen und die Verstaatlichung ihres Besitzes (Einziehung von Kirchengütern). [6] Vgl. Graumann, Die "Franzosenzeit“. [7] Zum Wiener Kongress, den auf ihm getroffenen Bestimmungen und den weiteren Implikationen vgl. u.a. Heinz Duchhardt, Der Wiener Kongress. Die Neugestaltung Europas 1814/15, 2. Aufl., München 2015; Michael Erbe, Revolutionäre Erschütterungen und erneutes Gleichgewicht. Internationale Beziehungen 1785-1830, Paderborn 2004 (Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen Bd. 5); Wolf D. Gruner, Der Wiener Kongress 1814/15, Stuttgart 2014; Reinhard Stauber, Der Wiener Kongress, Wien 2014 und Dieter Langewiesche, Europa zwischen Restauration und Revolution, 5. Aufl., München 2007 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte Bd. 13). [8] Vgl. dazu u.a. Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 200 Jahre Code civil im Rheinland, S. 104 und Stauber, Der Wiener Kongress, S. 95-96. [9] Vgl. Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 200 Jahre Code civil im Rheinland, S. 104 und 107; Franz Petri, Preußen und das Rheinland, in: Walter Först (Hg.), Das Rheinland in preußischer Zeit. Zehn Beiträge zur Geschichte der Rheinprovinz, Köln 1965, S. 43 und Gustav Croon, Der Rheinische Provinziallandtag bis zum Jahre 1874, Düsseldorf 1918 (Neudruck, Bonn 1974), S. 151-152. [10] Die Provinzialstände der Rheinprovinz stellten die Vertretung der Provinzbevölkerung, wie sie in vielen Territorien bis zur französischen Besetzung des Rheinlandes in Form der Landstände üblich gewesen war, dar. Die Provinzialstände hatten jedoch weitgehend nur beratende und gutachterliche Funktion (so sollten sie die preußische Führung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben durch Gutachten beraten) und besaßen nur auf dem Gebiet der provinziellen Selbstverwaltung einige Entscheidungsbefugnisse. Ein Gesetzgebungs-, Budget- oder Steuerbewilligungsrecht besaßen sie, anders als die alten Landstände, jedoch nicht. Das Recht auf Mitgliedschaft, also Vertretungsrecht, besaßen in der Rheinprovinz lediglich Angehörige der vormals unmittelbaren Reichsstände (Standesherren) und Grundbesitzer, die je nach Art und Größe des Grundbesitzes zu den Ständen der Ritterschaft (Besitzer eines landtagsfähigen Ritterguts), der Städte oder der ländlichen Grundbesitzer gehörten. Zu weiteren Information bzgl. der Entstehung, Geschichte, Entwicklung, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnissen der (Rheinischen) Provinzialstände vgl. u.a. Herbert Obenaus, Anfänge des Parlamentarismus in Preußen. Düsseldorf 1984; Croon, Der Rheinische Provinziallandtag; Gregor Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag 1826-1845, Köln 1994 (Rheinprovinz 9); Helmuth Croon, Die Provinziallandtage im Vormärz unter besonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, in: Peter Baumgart (Hg.), Städtetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung, Berlin 1983, S. 456-484; Joachim Stephan, Der Rheinische Provinziallandtag 1826–1840. Eine Studie zur Repräsentation im frühen Vormärz, Köln 1991 und Rückschritt oder Fortschritt? 27. März 1824 – Das Gesetz wegen der Anordnung der Provinzialstände für die Rheinprovinz, in: Archiv des LVR (Hg.), Zeit-Lupe, online
hier verfügbar
(abgerufen am: 03.05.2019). [11] Vgl. ebd., Bl. 1-3 sowie Carl H. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz: Johann Wilhelm Graf von Mirbach-Harff (1784-1849), Münster 2001. S. 353; Stephan, Der Rheinische Provinziallandtag, S. 94 und Croon, Der Rheinische Provinziallandtag, S. 152. [12] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 84. [13] Vgl. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 354-356. Die Sitzungsprotokolle des 10. Ausschusses befinden sich in: ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 266b (Verhandlungsunterlagen, Protokolle, Anlagen zum 1. Rheinischen Provinziallandtag, Bd. 2), Bl. 93-110. [14] Vgl. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 355 sowie ALVR Nr. 266b, Bl. 110 (Sitzungsprotokoll vom 05. Dezember 1826). [15] ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 264 (Sitzungsprotokolle des 1. Rheinischen Provinziallandtages), Bl. 71-72. Vgl. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 356-358. [16] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 84; Croon, Der Rheinische Provinziallandtag, S. 153 und Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 356. [17] Das Gutachten befindet sich in: ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 266a (Verhandlungsunterlagen, Protokolle, Anlagen zum 1. Rheinischen Provinziallandtag, Bd. 1), Bl. 180-197. [18] Vgl. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 357-361 und Croon, Der Rheinische Provinziallandtag, S. 155. [19] Vgl. ALVR Nr. 264, Bl. 147 und Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 362. [20] * 29.12.1777 in Mülheim am Rhein, † 14.01.1854 in Köln, vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 84. [21] Peter Heinrich Merkens besaß und führte als wohlhabender Kaufmann eines der größten Handelshäuser Kölns, betätigte sich ebenfalls als Bankier und nahm wichtige Ämter in Wirtschaft und Verwaltung war. So war er u.a. Mitglied und später Präsident der Kölner Handelskammer, Mitglied des Kölner Stadtrats und vertrat die Stadt von 1826 bis 1845 im Rheinischen Provinziallandtag, wo er die rheinisch-liberale Politik des Vormärz maßgeblich mitgestaltete. Vgl. Klara von Eyll, „Merkens, Peter Heinrich“, in: Neue Deutsche Biographie 17, 1994, S. 153-155. [22] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 84-85 und Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 362. [23] ALVR Nr. 266a, Bl. 226-228 (Votum des Abgeordneten Merkens zur Abstimmung über die Beibehaltung des Rheinischen Rechts, Sitzung 30. Dezember 1826). [24] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 85 und Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 362-363. [25] ALVR Nr. 266a. [26] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 85 und Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 363. [27] Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 86. [28] Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz, S. 363. [29] Für einen knappen biografischen Überblick vgl. Ernst Wunschmann, „Salm-Reifferscheid, Joseph Fürst und Altgraf zu", in: Allgemeine Deutsche Biographie 30, 1890, S. 255-257 sowie Martin Otto Braun, Elisabeth Schläwe und Florian Schönfuß (Hg.), Netzbiographie – Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773-1861), in: historicum-estudies.net, online hier verfügbar (abgerufen am: 03.05.2019). [30] Zitiert nach Croon, Der Rheinische Provinziallandtag, S. 157, Anm. 469. Vgl. Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag, S. 86. Benutzte und weiterführende Quellen und Literatur Quellen • ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 264 (Sitzungsprotokolle des 1. Rheinischen Provinziallandtages). • ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 265 (Eröffnungen an die Provinzial-Stände für die Rheinprovinzen wegen Einführung der Preußischen Gesetze in diese Provinzen, vom 23. Oktober 1826). • ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 266a (Verhandlungsunterlagen, Protokolle, Anlagen zum 1. Rheinischen Provinziallandtag, Bd. 1). • ALVR, Bestand Archiv der Provinzialstände der Rheinprovinz 1826–1888, Nr. 266b (Verhandlungsunterlagen, Protokolle, Anlagen zum 1. Rheinischen Provinziallandtag, Bd. 2). Literatur • Gregor Berghausen, Die großbürgerlichen Liberalen im Rheinischen Provinziallandtag 1826-1845, Köln 1994 (Rheinprovinz 9). • Carl H. Beusch, Adlige Standespolitik im Vormärz: Johann Wilhelm Graf von Mirbach-Harff (1784-1849), Münster 2001. • Gustav Croon, Der Rheinische Provinziallandtag bis zum Jahre 1874, Düsseldorf 1918 (Neudruck, Bonn 1974). • Helmuth Croon, Die Provinziallandtage im Vormärz unter besonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, in: Peter Baumgart (Hg.), Städtetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung, Berlin 1983, S. 456-484. • Klara von Eyll, „Merkens, Peter Heinrich“, in: Neue Deutsche Biographie 17, 1994, S. 153-155. • Sabine Graumann, 1794 bis 1815 - Aufbruch in die Moderne. Die "Franzosenzeit", in: Internetportal Rheinische Geschichte, online hier verfügbar (abgerufen am: 03.05.2019). • Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz (Hg.), 200 Jahre Code civil im Rheinland. Eine Ausstellung der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Saarbrücken und den Oberlandesgerichten Koblenz und Zweibrücken, Koblenz 2005 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 104). • Franz Petri, Preußen und das Rheinland, in: Walter Först (Hg.), Das Rheinland in preußischer Zeit. Zehn Beiträge zur Geschichte der Rheinprovinz, Köln 1965, S. 37-69. • Rückschritt oder Fortschritt? 27. März 1824 – Das Gesetz wegen der Anordnung der Provinzialstände für die Rheinprovinz, in: Archiv des LVR (Hg.), Zeit-Lupe, online
hier verfügbar
(abgerufen am: 03.05.2019). • Joachim Stephan, Der Rheinische Provinziallandtag 1826 bis 1840. Eine Studie zur Repräsentation im frühen Vormärz, Köln 1991.
|